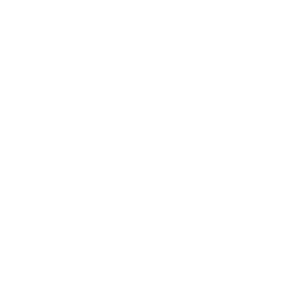Ein Wegweiser für die digitale Zukunft der deutschen Justiz
Eine der größten Herausforderungen für das deutsche Justizsystem ist die Digitalisierung. Digitale Lösungen sind entscheidend, um die Justiz trotz steigender Fallzahlen, wachsender Komplexität von Gesetzen und Prozessen sowie Personalmangel effektiv zu halten. Obwohl in den letzten Jahrzehnten Fortschritte erzielt wurden, ist der derzeitige Stand der Digitalisierung im Justizwesen noch nicht ausreichend.
Momentan arbeitet die Justiz an 21 Digitalisierungsprojekten, die bestehende Probleme lösen sollen. Die Umsetzung dieser Projekte ist jedoch mit verschiedenen Herausforderungen verbunden. Basierend auf einer Umfrage unter mehr als 50 Fachleuten aus der Justiz, ergänzender Experteninterviews und der Analyse öffentlicher Informationsquellen präsentiert diese Studie ein Zukunftsprogramm zur Digitalisierung der deutschen Justiz inklusive konkreter Umsetzungsmaßnahmen.
Die wesentlichen Schmerzpunkte der deutschen Justiz
Der Status quo der Digitalisierung im deutschen Justizwesen ist von vier wesentlichen Schmerzpunkten geprägt:
- 1Verfügbarkeit von IT-Expertise: Die begrenzte Verfügbarkeit von technologischen Fähigkeiten und IT-Expertise stellt eine Hauptbarriere für die Digitalisierung im deutschen Justizwesen dar, wobei fehlende Schulungen und wenig intuitive IT-Systeme die Situation verschärfen. Zudem mangelt es an einer übergreifenden Digitalisierungsstrategie, da bisherige Initiativen oft nur Einzelprozesse oder Teilbereiche adressieren.
- 2Leistungsfähigkeit der bestehenden IT-Ausstattung: Die Digitalisierung der deutschen Justiz leidet unter veralteter IT-Infrastruktur und unzureichenden Sicherheits- und Notfallkonzepten, was zu häufigen technischen Störungen führt. 33% der Befragten sehen Sicherheit und Vorsorge gegen IT-Ausfälle als zentrale Herausforderungen, während die Integration von Schnittstellen zu anderen Behörden wie der Polizei weiterhin im Aufbau ist.
- 3Analoge Prozesse: Die Digitalisierung der deutschen Justiz wird durch analoge Arbeitsprozesse, ineffiziente papierbasierte Aktenführungen und unzureichende IT-Infrastruktur erheblich verzögert, während die föderale IT-Heterogenität und rechtliche Ausnahmen von der Digitalisierungspflicht den Fortschritt weiter erschweren. Zusätzlich äußern viele Justizangestellte Datenschutzbedenken, was die digitale Transformation weiter hemmt.
- 4Personalverfügbarkeit: Die deutschen Staatsanwaltschaften stehen vor einer zunehmenden Arbeitsverdichtung mit einem steigenden Fallaufkommen, während rund 2.000 Stellen unbesetzt sind und der drohende Altersabgang ab 2027 die Personalnot weiter verstärken wird. Daneben sinkt die Attraktivität der Staatsanwaltschaften als Arbeitgeber.
Bestehende Digitalisierungsinitiativen und Umsetzungshürden
Die Digitalisierungsinitiative für die deutsche Justiz wurde im März 2023 von der damaligen Bundesregierung mit 200 Millionen Euro für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 ausgestattet. Bislang wurden 21 Digitalisierungsvorhaben identifiziert, die der Bund und die Länder beschlossen haben. Sechs Projekte werden derzeit auf Bundesebene umgesetzt, die anderen fünfzehn verantworten einzelne Länder mit spezifischer Themenführerschaft. Beispiele für zentrale Projekte sind unter anderem die Bundesjustiz-Cloud, das zivilrechtliche Onlineverfahren oder der digitale Austausch zwischen Polizei und Justiz. Das gemeinsame Ziel lautet: Übergreifende Standards entwickeln und föderale Innovationsräume nutzen.
Priorisiert sind die Projekte nach ihrer strategischen Bedeutung hinsichtlich Effizienzsteigerung, Nutzungsfreundlichkeit und Zukunftsfähigkeit der Justiz. Dabei gibt es allerdings große Hürden, die Verantwortliche aktuell bei der Umsetzung der Digitalisierungsinitiativen spüren:
Zukunftsprogramm für eine digitale Justiz
Angesichts der stockenden Digitalisierungsfortschritte ist ein Zukunftsprogramm für eine gemeinsame, nutzerorientierte und einheitliche Informationsarchitektur im Rahmen einer Verständigung zwischen dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) und den Landesjustizministerien notwendig. Dabei wird erwartet, dass das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz und die Landesjustizministerien die Digitalisierung der Justiz durch eine übergreifende Governance gemeinsam vorantreiben. Im Ergebnis müssen dadurch folgende Ziele verfolgt werden:
- Harmonisierung des Informationswesens der Justiz über Bund und Länder hinweg,
- Neuaufstellung der bisher heterogenen Datenhaltung durch eine gemeinsame Datenarchitektur sowie
- Schaffung einheitlicher Anwendungen für alle Beschäftigten in der Justiz
Im Rahmen der konzeptionellen Ausarbeitung des Programms sollten die 21 bestehenden Digitalisierungsinitiativen reevaluiert, auf Basis der gemeinschaftlichen Informationsarchitektur harmonisiert und im Zuge einer Fokussierung und Transformationsplanung auf ihre Priorität hin bewertet werden. Folgende vier Säulen werden dabei als notwendig angesehen:
1. Die Nutzungsfreundlichkeit aktueller Systeme verbessern
2. Die IT-Performance steigern
3. Digitale Schnittstellen und zentralen Datenaustausch implementieren
4. Effizienzsteigernde Automatisierung fachspezifischer Verfahren (z.B. durch KI)
Als begleitende Daueraufgabe, die konsequent berücksichtigt werden muss, sollten die Entscheider:innen Strategien zur Personalgewinnung entwickeln. Diese sollten ein modernes Arbeitsumfeld, gezielte Öffentlichkeitskampagnen, digitale Personalbeschaffungskanäle und Kooperationen mit Hochschulen umfassen.
Ausblick: Gemeinsam die Digitalisierung der Justiz vorantreiben
Mit dem Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD besteht die Chance, die dringend erforderliche digitale Transformation hin zu einer strukturierten, nutzerzentrierten und leistungsstarken Justiz in Deutschland mit neuer Dynamik anzugehen.
Unser Zukunftsprogramm für eine digitale Justiz definiert die zentralen Säulen, die für bessere Strukturen, eine benutzerfreundlichere Gestaltung und eine stärkere Leistungsfähigkeit des Justizwesens entscheidend sind. Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg dieser Initiative ist die Entwicklung eines zentralen Programms mit klarer Governance und ausreichender Finanzierung, um die Umsetzung unseres digitalen Zukunftsprogramms tatsächlich zu erreichen.
Carolina Stindt, Mara Sabel, Maria Klein, Lena Schäfer, Martin Bermes, Alexandra Rath, Johannes Freys, Katharina Brandenburger und Niklas Kelbch waren an der Erstellung der Studie beteiligt.